| Zeitschrift Umělec 2009/2 >> Österreich: Kulturnation ohne Kulturpolitik? | Übersicht aller Ausgaben | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Österreich: Kulturnation ohne Kulturpolitik?Zeitschrift Umělec 2009/201.02.2009 Monika Mokre | drehscheibe | en cs de |
|||||||||||||
|
Fragen Sie, wen Sie wollen – TouristInnen, Einheimische, Zugewanderte – es wird Ihnen immer bestätigt werden: Österreich ist eine Kulturnation. Und es werden Ihnen dafür auch Argumente genannt werden. Die Staatsoper, das Burgtheater, das Kunsthistorische Museum, die Salzburger Festspiele.
Fragen Sie vielleicht lieber keine zeitgenössischen KünstlerInnen oder Kulturinitiativen. Da könnte die Antwort zögerlicher ausfallen, etwa sogar auf mangelndes Interesse von Politik und Gesellschaft und sinkende Förderungen hingewiesen werden. Fragen Sie lieber einen Politiker oder eine Politikerin. Da wird Ihnen klar gesagt, wie wichtig die Kultur für Österreich ist, wie einzigartig die kulturellen Leistungen dieser Nation sind – und nicht zuletzt, wie sehr sich die öffentliche Hand für Kunst und Kultur einsetzt. Wenn Sie dann etwas konkreter nach kulturpolitischen Zielen und Leistungen fragen, werden Ihnen vermutlich im internationalen Vergleich nach wie vor eindrucksvolle Fördersummen genannt sowie als kulturpolitische Ziele die Erhaltung des kulturellen Erbes, große publikumsträchtige Festivals und die Creative Industries. Wenn Ihnen diese Zielsetzungen ein wenig unzusammenhängend erscheinen, ist das wenig erstaunlich, zeigt aber andererseits, dass Sie die historischen Entwicklungen und Verzweigungen der österreichischen Kulturpolitik nicht wirklich kennen. Die Wurzeln der österreichischen Kulturpolitik Die Wurzeln der österreichischen Kulturpolitik des 20. Jahrhunderts lassen sich ungefähr drei Jahrhunderte zurückverfolgen – doch keine Angst: Was hier folgt, ist keine umfangreiche historische Abhandlung, da diese Wurzeln erstaunlich stabil sind. Anders formuliert: So schrecklich viel hat sich in dieser Zeit nicht geändert, insbesondere nicht die Grundannahme, dass Kunst und Kultur eine gesellschaftliche Verantwortung sind und daher in erster Linie durch die öffentliche Hand finanziert werden müssen. Der Reichtum der Habsburger Monarchie und die dadurch mögliche großzügige Förderung der Kunst ermöglichten einerseits eine lang anhaltende Blüte der Künste und führten andererseits zu deren Abhängigkeit von staatlicher Förderung. Dieses Grundmuster hoher finanzieller Zuwendungen an die Kunst und starker Abhängigkeit der Kunst von der Politik überlebte das Ende der Habsburger Monarchie ebenso wie die zentralistische Struktur der Kunst- und Kulturförderung. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war also die österreichische Kulturpolitik stark von der Tradition der Monarchie geprägt – das betrifft sowohl die hohen Fördersummen als auch die Aufteilung dieser Förderungen, von denen seit jeher der Löwenanteil an das kulturelle Erbe (historische Gebäude, Museen, Opern und große Theater) geht. Kultur für alle Selbstverständlich kam es im Rahmen dieser allgemeinen Orientierung der österreichischen Kulturpolitik immer wieder zu neuen Schwerpunktsetzungen. Von besonderer Relevanz waren hier die gesellschaftlichen Veränderungen im Gefolge der 1968er-Bewegung und die sozialdemokratische Alleinregierung Anfang der 1970er. Zu dieser Zeit fanden erstmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs auch zeitgenössische Kunstformen sowie Kulturinitiativen mit breiteren gesellschaftlichen Zielen Beachtung in der österreichischen Kulturpolitik und wurden in Förderprogrammen berücksichtigt. Die Finanzierungshöhen blieben im Vergleich zum kulturellen Erbe stets verschwindend, reichten aber zur Entwicklung einer gewissen Dynamik in diesem Bereich aus. Die Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kulturinitiativen durch die Sozialdemokratie lässt sich zwar zum Teil aus politischen Zielsetzungen erklären, war aber auch wesentlich von der Notwendigkeit bestimmt, die konservative kulturelle Hegemonie zu brechen. Trotzdem blieb die sozialdemokratische Politik in diesem Bereich halbherzig und ohne konzises Programm. Kulturpolitik wurde unter dem Schlagwort „Kultur für alle“ als Teil einer generellen Wohlfahrtsorientierung konzipiert. In erster Linie ging es um die Öffnung der Hochkultur für breitere und auch eher bildungsferne Publikumsschichten. In diesem Konzept verband sich ein traditionelles Verständnis der erzieher-ischen Bedeutung von Kunst und Kultur mit egalitären Ansprüchen. Und es bedurfte nur einer sehr kleinen Akzentverschiebung, um daraus in den 1980ern die Forderung nach Kommerzialisierung abzuleiten: Ging es ursprünglich darum, den ungebildeten Massen Wertschätzung für Hochkultur beizubringen, so wurde später verlangt, dass sich Kunst und Kultur an den Wünschen des potenziellen Publikums orientieren. Zwar war die kulturpolitische Agenda der Sozialdemokratie widersprüchlich und letztendlich wenig einflussreich war, doch die prononcierte Umverteilungspolitik prägte die gesellschaftliche Entwicklung und politische Kultur des Landes entscheidend. In Österreich entstand ein außerordentlich starker und erfolgreicher Wohlfahrtsstaat mit einem hohen Maß an sozialer Sicherheit. Doch während das dichte soziale Netz tatsächlich für die gesamte Bevölkerung von Relevanz war, wurde mehrfach empirisch bewiesen, dass Arbeitsplatzsicherheit in regulären Arbeitsverhältnissen stets nur auf einen Teil der Arbeitskräfte zutraf, nämlich auf männliche, inländische Beschäftigte in den großen Industrien. Frauen und MigrantInnen waren stets von Prekarisierung bedroht - wie auch diejenigen KünstlerInnen, die nicht in den großen Prestigeinstitutionen des kulturellen Erbes beschäftigt waren. Trotzdem stellte das politische Ziel von sozialer Sicherheit und Vollbeschäftigung einen mindestens diskursiven Fixpunkt dar, der Kritik an bestehenden Verhältnissen ermöglichte. Auch führten kontinuierliche Debatten über die stark ungleiche Verteilung staatlicher Förderungen dazu, dass die geringen Subventionen für freie Kunst- und Kulturprojekte immerhin parallel zu den Finanzierungen für die großen Institutionen gesteigert wurden. Dadurch gelang es diesen Projekten und Initiativen, sich einigermaßen zu etablieren und auch Diskurse zu beeinflussen. Für Kulturinitiativen stand dabei der Anspruch nach gesellschaftlicher Relevanz im Vordergrund. In den 1970ern wurde der Begriff Kulturarbeit geprägt, der sich gegen den Mythos der autonomen Kunst und zugleich auch gegen die Einschränkung des Arbeitsbegriffs auf (fordistische) Lohnarbeit richtete. Kulturarbeit stand für partizipative, politisch engagierte Arbeit im kulturellen Feld und/oder mit kulturellen bis künstlerischen Mitteln, wobei die Akzeptanz durch den Kunstbetrieb zweitrangig war. Der Ansatz der klassischen Avantgarde, die Trennung zwischen „Kunst und Leben“ aufzuheben, sollte in konkreten lokalen Kontexten wieder belebt werden. Im Gegensatz zum Kunstbetrieb ging es nicht in erster Linie um die Schaffung neuer Werke, sondern auch darum, kulturelle Produktionen etc. zu ermöglichen und durchzuführen, zu veranstalten. Kulturelle Arbeit wurde nicht mehr als Schöpfungsakt eines Individuums aus dessen Inneren verstanden, sondern als kollektiver Prozess, an dem auch Nicht-ExpertInnen teilnehmen können bzw. dessen Ergebnisse breiter zugänglich sein sollen. In den 1980ern setzte eine Phase der Institutionalisierung ein – Vereine wurden gegründet, Infrastrukturen errichtet, in den meisten Fällen ehrenamtlich und selbstbeauftragt und oft abseits der Zentren, mit dem Ziel einen anderen Kulturbegriff neben Hochkultur und volkstümelnder Kultur zu etablieren – die Soziokultur. Kulturpolitik als Wirtschaftspolitik Mit den 1990er Jahren ging jedoch auch die letzte Phase des sozialdemokratisch orientierten Wohlfahrtsstaates zu Ende und ein neues politisches Paradigma - das sich bereits in den Diskussionen um die ökonomische Bedeutung von kulturellen Großveranstaltungen in den 1980er Jahren angekündigt hatte - setzte sich fest: die Geschichte von unmittelbar ökonomisch verwertbarer Kunst/Kultur. Die Kreativwirtschaft wurde auch in Österreich entdeckt, auch wenn die ersten Versuche, das Konzept der CI in Österreich einzuführen, von Hilflosigkeit und Verwirrung geprägt waren. Wenn im Jahr 2000 der damals frisch gebackene Staatssekretär Franz Morak von den CI sprach, war offensichtlich, dass er nicht wirklich wusste, wovon er redete und hoffte, dass die österreichischen CI aufgrund ihrer bloßen Erwähnung in diesen Reden entstehen würden. Auch die politischen Aktivitäten zur Förderung der Kreativ- wirtschaft in Österreich waren und sind wenig effektiv. So wurde etwa ein kreativwirtschaftlicher Cluster im MuseumsQuartier Wien geschaffen, also an einem sehr zentralen und prominenten Ort. Das Wiener MuseumsQuartier wurde nach jahrzehntelangen Diskussionen im Jahr 2001 eröffnet und stellt in erster Linie ein Konglomerat verschiedener Museen dar. Es verdankt seine Gründung erstens der Tatsache, dass sich nahe dem Wiener Zentrum historische Gebäude befanden, die neu genutzt werden mussten, und zweitens dem Platzbedarf einiger großer Museen. Da die Ansiedlung mehrerer Museen in einem historischen Gebäudekomplex wenig zeitgemäß und attraktiv erschien, wurde ein Feigenblatt benötigt, um das MuseumsQuartier als lebendiges Kulturareal des 21. Jahrhunderts zu verkaufen - und dieses Feigenblatt ist das „Quartier 21“, in dem Räume für zeitgenössische künstlerische und kulturelle Produktion und insbesondere für die Kreativwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Art kann das MuseumsQuartier von sich behaupten, dass es sich nicht nur der Repräsentation von Kunst widmet, sondern auch ihrer Produktion, dass es nicht nur ein Ort des kulturellen Erbes ist, sondern zugleich einer zeitgenössischer künstlerischer Aktivität. Die konkrete Umsetzung dieser Idee zeigt einerseits die Ungebrochenheit des paternalistischen top-down-Zugangs der österreichischen Kulturpolitik und andererseits die Schwierigkeiten, aus dieser Tradition heraus einen adäquaten Umgang mit den Strukturen der Kreativwirtschaft zu entwickeln: Die Verwaltungsgesellschaft des MuseumsQuartiers (die sich im Eigentum der öffentlichen Hand befindet) will mit dem „Quartier 21“ Profite erzielen und verlangt daher Mieten für die dort zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Diese Mieten sind wiederum staatlich gestützt; da Mietpreise in diesem Teil von Wien sehr hoch sind, übersteigen sie aber trotzdem die finanziellen Möglichkeiten kleiner, neu gegründeter Firmen mit hohem Risikopotenzial. Daher mussten viele der Mikrounternehmen, die in einer ersten Welle der Euphorie in das „Quartier 21“ einzogen, ihre Räumlichkeiten wieder aufgeben, und sehr bald wurde das einzige Kriterium für die Auswahl der MieterInnen ihre Fähigkeit, die Miete zu bezahlen. Dies führte dazu, dass sich im „Quartier 21“ eine Fülle sehr unterschiedlicher Organisationen befinden, zwischen denen sich kaum Synergien entwickeln. Ähnlich problematisch sind auch finanzielle Förderungen für die Kreativwirtschaft. Nicht Strukturen werden gefördert, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen würden, sondern Einzelprojekte, nach deren Abschluss die ProjektbetreiberInnen häufig wiederum keine finanziellen Mittel für ihre weitere Arbeit haben. Und auch die Formalitäten zur Einreichung solcher Projekte sind so bürokratisch, dass sie kleinere Unternehmen und insbesondere die Ein-Personen-Unternehmen, die den Großteil des kreativwirtschaftlichen Sektors ausmachen, überfordern. Zeit für eine österreichische Kulturpolitik Was ist also das Resumée dieser Tour de Force durch die österreichische Kulturpolitik? 1. Für das kulturelle Erbe ist gut gesorgt. 2. Die (gar nicht so) fetten Jahre sozialdemokratischer Kulturpolitik sind vorbei (da sich auch die mehrheitlich sozialdemokratische Regierung der letzten Jahre an Marktfähigkeit und kommerziellem Erfolg orientierte) und die Hauptleidtragenden sind Kulturinitiativen und politische Kunst, die nach dem kurzen und beschränkten Aufschwung der 1970er und 1980er hart um ihr Überleben kämpfen. 3. Statt dessen wird Kulturpolitik zunehmend mehr zu einem Anhängsel der Wirtschaftspolitik umgedeutet, wobei es auch in diesem Bereich an effektiven Maßnahmen fehlt. Keine Frage: Auch auf die Art kann Österreich noch längere Zeit eine Kulturnation bleiben; das kulturelle Erbe bleibt uns ja erhalten. Künftige Generationen werden allerdings nur das kulturelle Erbe der Großeltern und Urgroßeltern bestaunen können, da ihre Eltern ein solches wohl nicht hinterlassen werden. Und, wichtiger: Die potenzielle kulturelle Produktivität zeitgenössischer KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen geht verloren. Würde uns also die neue Regierung, die im September gewählt wird, so wie eine gute Fee drei Wünsche freistellen, so könnten die etwa so aussehen: 1. eine Kulturpolitik, die klare und nachvollziehbare Ziele hat, deren Erreichung auch überprüfbar ist; 2. eine Kulturpolitik, die sich der eigenständigen gesellschaftlichen Leistungen von Kunst und Kultur bewusst ist; 3. eine Kulturpolitik, die einen Schwerpunkt auf zeitgenössisches künstlerisches und kulturelles Schaffen legt. Ob diese Wünsche nicht nur einer Fee, sondern auch einem/r Kunst- und KulturministerIn einleuchten können?
01.02.2009
Empfohlene Artikel
|
|||||||||||||
|
04.02.2020 10:17
Letošní 50. ročník Art Basel přilákal celkem 93 000 návštěvníků a sběratelů z 80 zemí světa. 290 prémiových galerií představilo umělecká díla od počátku 20. století až po současnost. Hlavní sektor přehlídky, tradičně v prvním patře výstavního prostoru, představil 232 předních galerií z celého světa nabízející umění nejvyšší kvality. Veletrh ukázal vzestupný trend prodeje prostřednictvím galerií jak soukromým sbírkám, tak i institucím. Kromě hlavního veletrhu stály za návštěvu i ty přidružené: Volta, Liste a Photo Basel, k tomu doprovodné programy a výstavy v místních institucích, které kvalitou daleko přesahují hranice města tj. Kunsthalle Basel, Kunstmuseum, Tinguely muzeum nebo Fondation Beyeler.
|

























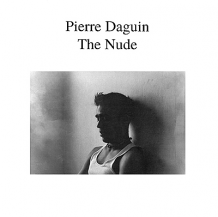










 We Are Rising National Gallery For You! Go to Kyjov by Krásná Lípa no.37.
We Are Rising National Gallery For You! Go to Kyjov by Krásná Lípa no.37.
Kommentar
Der Artikel ist bisher nicht kommentiert wordenNeuen Kommentar einfügen