| Zeitschrift Umělec 2011/1 >> Musik, deren Gesten unsichtbar bleiben, die dennoch jeder hören will | Übersicht aller Ausgaben | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Musik, deren Gesten unsichtbar bleiben, die dennoch jeder hören willZeitschrift Umělec 2011/101.01.2011 Jozef Cseres | musik | en cs de ru |
|||||||||||||
|
Zwar gibt es weit weniger Methoden und Strategien, zeitgenössische Musik in den verworrenen Labyrinthen ihrer Ausdrucksformen zu erfassen, als es musikalische Erscheinungsformen gibt, aber dennoch existieren deutliche Parameter (oder eher Tendenzen), mit denen sie mehr schlecht als recht charakterisiert und von der Musik der vorigen Jahrzehnte unterschieden werden kann. Zu diesen Parametern gehören mit Sicherheit die intermediale Orientierung sowie die technische Anspruchslosigkeit der Musikproduktion. Erstere führte die zeitgenössische Musik an die interaktiven Multimedien und die sogenannte Sound Art heran, zweitere erleichterte sie um ihre Gestik und Performativität – zwei für die Kommunikation mit dem Zuhörer unabdingbare Attribute. Beide Eigenschaften verbindet eine laxe, manchmal gar ignorante Haltung gegenüber der musikalischen Tradition, die die Grenzen der poetischen, stilistischen und repräsentativen Konzepte und Innovationen überschreitet, die aus der bisherigen Avantgarde bekannt waren. Die elektronischen Gesten der gegenwärtigen „Laptopmusiker“ und „Sound Artists“ differieren deutlich von den elektronischen Gesten eines Xenakis, Ferrari, Schaeffer, Cage, Tudor, Lucier, Behrman, Rosenboom, Teitelbaum, Niblock, Rowe, Zappa, Collins, Marclay, Tone, Otomo oder anderen prominenten Vertretern der elektronischen Musik aus den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.
In erster Linie sind die neuen Musiker weder ursprünglich noch radikal. Sie sind erzwungen elektronisch, da die totale Digitalisierung der Medien eine neue technologische Gegenwart erschaffen hat (die universale Sprache und den kommunikativen Raum der elektronischen Medien). Und von dieser ist ein Großteil der kulturellen und somit auch musikalischen Produktion abhängig. Diese Musik ist nicht ursprünglich, weil ihre Ästhetik auf den poetischen Experimenten und Entdeckungen von Künstlern aufbaut, die noch mit analogen und zu ihrer Zeit kostenaufwendigen, schwer erreichbaren Medien gearbeitet haben. Und sie ist auch nicht radikal, da es sich bei ihren scheinbar unkonventionellen Konzepten größtenteils um recycelte seelenlose Klischees handelt, die den von ihnen fetischisierten technischen Errungenschaften nur nachlaufen. Und Radikalität täuscht die zeitgenössische Musik oftmals nur vor. Nichtsdestotrotz sind die elektronischen Künste mit ihrer „Leichtigkeit des Seins“ und „endlosen Weite“ – um die Worte des Philosophen Wolfgang Welsch zu gebrauchen – im Zuge der voranschreitenden Technokratisierung heute in der Lage, die Pluralität der menschlichen Realität und das Gefühlsleben ihrer Schöpfer und Empfänger in einer bewundernswerten Symbiose zu artikulieren. Für die moderne Musik zählt dies umso mehr, da bereits ihre Vorgänger der nicht-elektronischen und nicht-digitalen Ausdrucksformen in der virtuellen Zeit operierten. Nachdem einige Musiker (Xenakis, Cage, Lucier und später noch viele andere) begannen, sich intensiv für die räumlichen Phänomene der Musik zu interessieren, spielte sich die Musik nicht mehr nur in der Zeit, sondern auch im Raum ab. Stereophone beziehungsweise quadrophone Effekte sollten das Hörerlebnis bereichern, da der Zuhörer in Folge der Ersetzung lebender Interpreten durch technische Reproduktionsanlagen die visuelle Kontrolle über den Generierungsprozess der Klänge verlor (eine Lautsprecherwand oder einen klickenden „Laptopper“ anstelle einer spielenden Band oder eines jonglierenden DJs anzustarren, ist wirklich kein Vergnügen). Nach der Live Electronics-Ära, die die elektronische Musik in den „Augen“ der neugierigen Zuhörer dank der Bewegungen und Gesten der Beteiligten teilweise rehabilitierte, kamen elektronisch generierte Bilder der Musik zur Hilfe. Zunächst als simultane Video-Projektionen, später als interaktives Multimedium, das in Realzeit auf Töne reagiert oder diese direkt beeinflusst. Nach dem DJ wird der VJ zum angesagtesten Performer des Augenblicks – als elektronische Bilder und Töne im beschleunigten, nervösen Tempo des audiovisuellen Zeitalters mischendes Medium. Aus gefundenen und angeeigneten Tonfragmenten und visuellen Strukturen komponieren die heutigen D- und VJs vibrierende, wechselhafte Ströme synergistischer Sinnesblöcke, um so ihren Empfänger affektiv in den Handlungsprozess miteinzubeziehen, in dem beide (Künstler und Empfänger) „ständig ein Anderer werden“ (Deleuze und Guattari). Ebendort sind die „mühsamen“ Zeiten zu finden, in denen Cage geduldig seine „Grammophon-Opératiques“ überspielte oder Marclay seine phonographischen Paraphrasen mit rein künstlerischen Absichten leidenschaftlich collagierte. Die neuen flexiblen Technologien haben die Grenzen zwischen Klang und Visualität in digitalen audiovisuellen Speichermedien verwischt, deren Inhalt sich nun ausschließlich nach (subjektiven) phänomenologischen und keineswegs nach (objektiven) hierarchischen Kriterien (qualitativ und quantitativ) verändert. Notenschrift, Musizieren und Experimentieren wurden durch die zu jeder Zeit und von jedem Ort zugänglichen technologischen Archive und Kataloge durch Klänge und Bilder ersetzt, die je nach aktuellem Bedarf augenblicklich heruntergeladen werden können. Dank der tragbaren Mini-Kameras (oder sogar Video-Handys), die außer dem primären Bild auch den sekundären Ton aufnehmen, besitzen diese Archive heutzutage einen audiovisuellen Charakter. Die Videoaufnahme übertrifft die bekannte bipolare Klassifikation McLuhans in heiße und kalte Medien. Sie erweitert mehrere Sinne zugleich und ist dabei hochauflösend. Auf die audiovisuelle Kunst angewandt hat Nicolas Collins dies schön erfasst: „Es ist nicht so, dass es heute viel mehr Sound Art als vor zwanzig Jahren gäbe, heute beinhaltet Kunst einfach häufiger Töne. Dank der allgegenwärtigen Videokameras als neues Skizzenheft und Laptops als universale Cutter nehmen die Künstler zusammen mit dem visuellen Material jedesmal auch Audio auf; vielleicht hören sie bei Beobachtung und Aufnahme nicht so aufmerksam wie sie schauen, wenn sie das Material aber schneiden, sind sie gezwungen, sich die Synchronisationstöne anzuhören (außer falls die Lautsprecher absichtlich heruntergedreht wurden). Der Schneideraum ist ein toller Ort, an dem man viel über den Ton erfahren kann … An der Kunsthochschule, an der ich unterrichte, arbeiten beispielsweise so gut wie alle Studenten auf irgendeine Weise mit Tönen (so wie alle Kunststudenten gewohnt sind zu zeichnen), und ein Großteil von ihnen absolviert wenigstens einen Kurs an unserer Fakultät [für Musik]. Einige kommen dabei dem „reinen Klang“ so nahe, dass sie zu Komponisten werden. Sie stammen aus einem anderen Umfeld (dem der visuellen Künste) und beherrschen meist keine musikalischen Fertigkeiten, verwenden aber die gleichen Instrumente wie Popmusiker oder Studenten am Konservatorium. In heutigen Zeiten ist es manchmal schwer, die „Klänge“ der Künstler von der „Musik“ der Komponisten zu unterscheiden. Ganz zu schweigen von der Ursprünglichkeit der Klänge (und Bilder), mit denen die Künstler heute arbeiten! Es ist tatsächlich so: „Derivierte“ Kunst, egal ob Klang oder Bild, kümmert sich kaum um Ursprünglichkeit (auch um die Ursprünglichkeit formaler Konzepte) und Traditionen, weshalb sie sich auf immer unsichererem Terrain am Rande der poetischen Originalität und des Plagiats bewegt. Hier wiederum die Erfahrungen eines der Höchstberufenen: „Seit der Ambient-Bewegung in den neunziger Jahren“, so Collins in diesem Zusammenhang, „existiert ein breiter Crossover junger Künstler mit Pop-Background, die in die sogenannte Klassische Musik gewechselt sind. Viele von ihnen haben eine sehr selektive Sicht auf die Musikgeschichte, was natürlich nicht immer negativ sein muss. Obwohl ich bei Alvin Lucier studiert habe, war ich mir immer der Bedeutung des historischen Kontextes aller Musikrichtungen, die ich hörte, bewusst. Es existierte ein Verbindungsnetz aus anderen Werken und Künstlern, ich las die Texte auf den Albumcovern. Die iPod-Generation meiner Studenten denkt jedoch in Begriffen von Verzeichnissen und Ranglisten. ‚Wenn es sich gut anhört, behalte ich es und benutze es vielleicht sogar in meiner eigenen Arbeit‘, sagen sie und gehen mit jeder Art von Musik nach ihrem phänomenologischen Wert wie mit KLANG um. Sie haben keine Begleittexte oder lesen sie nicht. Ich vermute, dass es für sie als Musikkonsumenten (ihre ‚Sammlungen‘ sind viel eklektischer als meine in ihrem Alter – dabei war ich ein sehr abenteuerlicher Hörer) und vielleicht auch als Künstler sehr befreiend sein muss, den Ballast der Geschichte abwerfen zu können. Dies hat natürlich auch eine negative Seite, nämlich eine Menge nicht-ursprünglicher, abgeleiteter Musik. Wie ich schon sagte, die Aufgabe eines jeden Hörers ist, das Gute vom Schlechten zu trennen (so subjektiv wie möglich), eine Art Lektor zu spielen.“ Und so verbreitete sich mit Hilfe der Videokamera die Klangkunst vor allem in den darstellenden Kunstkreisen, wo sie jedoch zumeist einer qualitativ besseren und vor allem sinnvolleren poetischen Grundlage entbehrt. Dort ist sie vielmehr nur ein Ausdruck leicht erlernbarer Handfertigkeiten. Die heutigen visuellen oder audiovisuellen Künstler beschäftigen sich in seliger Unwissenheit mit poetischen Problemen, die schon längst von musikalischen Avantgardisten mit unflexiblen analogen Medien im Kontext der sukzessiven Entwicklung des musikalischen Denkens gelöst wurden. Darüber hinaus hat die technische Anspruchslosigkeit der musikalischen Strukturierung auf soziologischer Ebene deutlich zu einer neuen Art elitärer Abgrenzung (durch Clubs, Labels etc.) gegenüber dem Mainstream geführt, von dem sie sich jedoch nicht durch ihre künstlerische Überzeugungskraft, sondern lediglich durch ihr sorgfältig erstelltes Image und Renommee unterscheidet. Doch bereichern diese Künstler die Musik nicht, sondern degradieren sie auf das Niveau oberflächlicher Peinlichkeit (ein ausgeprägtes Beispiel in Tschechien ist die sehr populäre Produktion der Gruppe Midi Lidi). Kurzum, so wie einstmals das poetische Prinzip der „neuen Einfachheit“ nicht nur auf einigen sentimental auf der Gitarre gezupften Akkorden beruhte, reicht auch heute das Klicken, Mixen, Downloaden oder Streamen nicht aus. Es geht, aber es reicht nicht! Die historische und kontextuelle Situation der sechziger Jahre wiederholt sich nämlich nicht. Die Minimalisierung der Ausdrucksmittel, die Entblößung der Medien, die Aufgabe von Virtuosität und handwerklicher Fertigkeiten der Künstler der Fluxus- und Rock-Generation sowie ihr häretischer Umgang mit Traditionen basierten auf völlig anderen soziologischen Gegebenheiten. Und auch die postindustrielle Situation, auf die in den neunziger Jahren die japanischen Noise- und Onkyo-Szenen reagierten, wiederholt sich nicht. Poetischer Eklektizismus, intermediale Orientierung und technologische Hingabe können dabei effektiv mit einer konzeptuellen Perspektive, einem Sinn für Experimente, beherrschtem Können, ästhetischer Überzeugungskraft, mit einem passend gewählten Kontext und Respekt vor der Tradition verknüpft werden. Doch das ist nicht unbedingt die Devise der meisten heutigen Musiker und Sound Artists. Hervorragende Beispiele dafür, wie eine gelungene Fusion kreativer Stimuli und Outputs aussehen könnte, sind die Werke von Alvin Curran oder Jon Rose. Die beiden Musiker stammen aus verschiedenen Generationen mit unterschiedlichen Backgrounds und sind bereits seit mehreren Jahrzehnten in der progressiven Musikszene unterwegs. Curran hat eine akademische Eliteausbildung genossen (u.a. studierte er Komposition bei Elliott Carter in Yale und Berlin) und begann seine professionelle Musikkarriere im Jahre 1963 in Berlin als hoffnungsvoller Adept der postseriellen Komposition, um frühzeitig vor dem Akademismus in das damals liberalere Rom zu fliehen. Dort ging er zu den aktuellen Erscheinungsformen der Improvisation über, den Live Electronics, Musik im Raum und Klanginstallationen. Rose ist eigentlich ein experimentierender Autodidakt, der sich in den siebziger Jahren zunächst durch die Straßen und Clubs der australischen Großstädte schlug und verschiedenste Musikrichtungen ohne Einschränkungen in Genre und Stil spielte. Ab der zweiten Hälfte der Achtziger entwickelte er inmitten der euro-amerikanischen Musikavantgarde sein langfristiges Konzept The Relative Violin, mit dem er direkt in die Entwicklung musikalischer Improvisationen, Radio Art, Environmental Sound Art und interaktiver Elektronik eingriff. Mit dem Einfallsreichtum, der Originalität, Anpassungsfähigkeit, Transmedialität, Frische und Aktualität ihrer künstlerischen Kreationen stellen Curran und Rose die radikalen Avantgardisten aller Nach-Cage-Generationen in den Schatten. Die interaktiven audiovisuellen Installationen von Curran und Rose sind genau so „jung“ (in poetischer und technischer Hinsicht) wie alle anderen postmodernen Multimedien, doch mangelt es ihnen nie an philosophischer Munition und humorvoller Distanz. Beide sind in der Lage, eine für die Zuschauer langweilige Notebook-Kreation mit ansprechenden, lebendigen Gesten und einem passenden akustischen Kontext zu verbinden. Es ist gerade diese Fähigkeit, die den jüngeren Experimenteuren und Möchtegern-Improvisateuren fehlt. Deren Improvisationen scheitern oftmals am Versagen des Computers oder dem Ausschalten der Stromquelle (sowie leider auch an mangelnden Förder- oder Stiftungsgeldern). Die routinierten Musiker Curran und Rose hingegen beweisen uns jedes Mal aufs Neue, dass sie live mit ihrem prompten Einfallsreichtum auch aus technischem Versagen und Fehlern überzeugende Kunst herausholen können. Auf hoher Realisierungsebene exemplifizieren sie alle Merkmale des Liberalismus und transversalen Pluralismus der Postmoderne, also genau jene Prinzipien, die die zeitgenössische Künstlergeneration zwar theoretisch und poetisch anerkennt und vehement proklamiert, die sie jedoch aufgrund ihrer übermäßigen technischen Abhängigkeit, ihrem Analphabetismus oder Halb-Analphabetismus im Bereich der traditionellen gestalterischen Prozesse und Medien sowie auch wegen ihrer Ignoranz gegenüber der Tradition praktisch nicht beherrscht. Darüber hinaus unterliegt sie technokratischen und kuratorischen Trends, die sie fälschlicherweise mit poetischen Prinzipien verwechselt. Alvin Curran und Jon Rose habe ich als repräsentative Beispiele für die neue musikalische Denkweise der postmodernen Ära angeführt. Diese Denkweise unterwirft alle poetischen und technischen Errungenschaften der künstlerischen Nachkriegs-Avantgarden, die eher intelligibel und konzeptuell als sensibel und ästhetisch ausgerichtet waren, einer kritischen und zugleich exploitierenden Rezension. Der sonoristische Liberalismus, die unidiomatische Improvisation und die interaktiven Live Electronics der vergangenen zwei Jahrzehnte führten beide Orientierungstypen in einen lebensfähigen, vibrierenden, veränderlichen, unhierarchischen, ästhetisch ansprechenden und immer weniger differenzierbaren Strom elektronischer audiovisueller Gesten individueller und kollektiver Natur, bei denen sich nur die Instabilität als stabil erweist. Ein Strom, in dem sich unzählige Musiker in unerwarteten (aber doch zu erwartenden) Konstellationen treffen können und auch tatsächlich treffen: Alvin Curran, Richard Teitelbaum, Christian Wolff, Yasunao Tone, Phill Niblock, Keith Rowe, John Tilbury, George Lewis, Butch Morris, Evan Parker, Jon Rose, Nicolas Collins, John Zorn, Fred Frith, Christian Marclay, David Shea, Bob Ostertag, Kronos Quartet, Miya Masaoka, Otomo Yoshihide, Merzbow, Toshimaru Nakamura, Günter Müller, Lawrence Casserley, Adam Bohman, Francisco Lopez, Phil Durrant, Kaffe Matthews, Jim O’Rourke, The Ex, Sonic Youth, Mike Patton, Alan Licht, Tony Buck, DJ Olive, Ikue Mori, z’ev, Alessandro Bosetti, Oren Ambarchi, Domenico Sciajno, Fennesz, Franz Hautzinger, Axel Dörner und viele weitere Persönlichkeiten haben das Wesen der Musik in den vergangenen Jahrzehnten stark beeinflusst und werden dies auch zukünftig tun. Die Leichtigkeit und Unverbindlichkeit, mit der es zu diesen Treffen kommt, könnten bei manch einem ein „Kompositionsnetzwerk“ à la Jacques Attali evozieren – eine Musik, die aus der Erzeugung von Differenzen zum eigenen Vergnügen erschaffen wurde –, wenn sich die Gesten und individuellen Beiträge der oben angeführten Musiker, obgleich authentisch, ehrlich und gut gemeint, nicht im Nachhinein in von institutionellen Aufträgen erzwungenen Repetitionen auflösen würden. Einerseits werden die spontanen lebendigen Gesten auf dem Podium in elektronischen Datenträgern abgetötet, andererseits werden sie von der technokratischen Stilisierung der Musiker und audiovisuellen Künstler aus der jüngeren Laptop-Generation abgeschliffen. In diesem Fall haben wir es aber nicht mehr mit einem poetischen und ästhetischen Reduktionismus, Minimalismus oder einer „neuen Einfachheit“ zu tun, sondern mit einem raffinierten Diktat der Technik. Die in ihren Produktionen auf frischer Tat ertappte Realität wird über die Prismen der technischen Innovationen distanziert. Dies ist eine natürliche Folge des rückwirkenden Einflusses der elektronischen Welten auf die (nicht nur künstlerische) Wirklichkeit. Die Autoren der digitalen Kunstwerke artikulieren die Pluralität der postmodernen Situation nicht mehr mit Hilfe kultureller und semantischer Differenzen, sondern durch elitäre und technische Vereinheitlichungen, die auf deutliche Weise ihre und unsere Erfahrungen modifizieren. Digitale Gesten verbleiben darüber hinaus zumeist unsichtbar. Den Zuhörern oder Zuschauern verbleibt daher lediglich der Glaube, dass sich hinter den wahrgenommenen Klang- oder Bildanimationen die tatsächlichen Bewegungen eines Künstlers verbergen. Und dank ihrer eigenen Erfahrung mit Grammatik und Syntax der elektronischen Medien werden sie dies nur zu gern glauben. So ist also aus einer Musik mit modernistischer Tradition, die bis vor kurzem noch keiner hören wollte, eine Musik geworden, die überall und von allen gehört wird. Beide Varianten erfüllen mich mit Skepsis. Abgesehen davon, dass sie die Hörer in eine unerwünschte Richtung lenken – die eine in das Gebiet des konzeptuellen Elitentums, die andere in die konsumorientierte und technokratische Welt redundanter Repetitionen – entbehren sie jener Wonne an der Erzeugung und Wahrnehmung von Differenzen, von der Roland Barthes einst schrieb und Jacques Attali bis heute träumt. Die drängende Frage des Modernismus „Wie?“ hat sich in Zeiten der synchronen, transversalen und interaktiven Artikulation und Informationsverbreitung, der extensivierten und intensivierten Geschwindigkeit flexibler Technologien in die Frage „Wann und wo?“ gewandelt. Niemand hat heute allerdings mehr die Zeit und Geduld, auf die Antwort zu warten beziehungsweise niemand will riskieren, die bereits erahnte Antwort zu erhalten, die da lautet: „Schon gestern!“ Aus dem Tschechischen von Filip Jirouš.
01.01.2011
Empfohlene Artikel
|
|||||||||||||
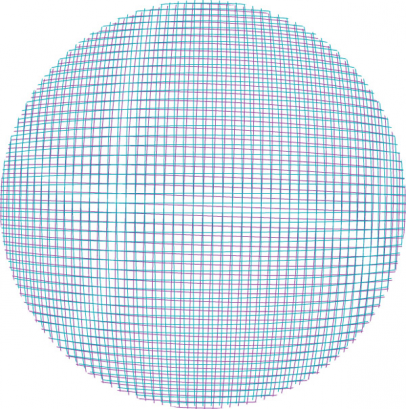






Kommentar
Der Artikel ist bisher nicht kommentiert wordenNeuen Kommentar einfügen