| Zeitschrift Umělec 2007/3 >> Sonntagmorgen | Übersicht aller Ausgaben | ||||||||||||
|
|||||||||||||
SonntagmorgenZeitschrift Umělec 2007/301.03.2007 Arlene Tucker a Sarah Lippek | expedition | en cs de es |
|||||||||||||
|
Drei junge Frauen wagen sich in das verlassene Pockenkrankenhaus auf
Roosevelt Island, nahe Manhattan In New York kann das Betreten eines Bürohochhauses eines, in dem man einen völlig legitimen und professionell vereinbarten Termin mit einem einwilligenden Gastgeber hat – zahlreiche Komplikationen am Checkpoint mit sich bringen. Eintrag in eine Liste, Vorlage von Dokumenten zur Identifikation, Scannen der Dokumente, Ausstellung einer befristeten Fotokarte und eines Barcodes, Aufkleber, Angabe von Namen, Adresse und Zweck des Besuchs, ein Anruf, und schließlich das Weitergehen mit Eskorte. Auch die Straßen sind streng bewacht. Tausende von Kameras surren Tag und Nacht auf Pfeilern, an Wänden, in Garagen und neben Straßen und Brücken. Das Gefühl von Einsamkeit wird hier untergraben. Die Stadt vermischt Überwachung mit Vernachlässigung man wird beobachtet, aber nicht gesehen; verfolgt, aber nicht gewollt; man steht zur Verfügung, wird aber nicht gesucht. Die Lücken zwischen den Sehwinkeln schließen sich schnell. Es gibt nur noch wenige tote Winkel in der Stadt, sehr wenig Privatsphäre im öffentlichen Raum. Vor diesem Hintergrund erscheint es fast gierig, Zuflucht zu erwarten, geschweige denn sie in der Mitte des East River zu erwarten, auf Roosevelt Island. Und doch, an der südlichen Spitze der Insel zwischen Manhattan und Queens, auf einer künstlichen Wiese, die in zwei Richtungen mit beeindruckenden Blicken auf die Skyline gesegnet ist, steht eine Schlossruine, eine verlassener Ort, unberührt von den Diktaten der Zweckmäßigkeit. Diese Ruine ist unbeobachtet. Das Roosevelt Island Pockenkrankenhaus steht seit mehr als fünfzig Jahren leer. Früh genug am Tag, um davon ausgehen zu können, dass die Inselbewohner noch vor sich hin schlummern, klettern wir drei Frauen über den verketteten Zaun. Vorsichtig nach rechts und links schauend und mit Augen nach hinten, passieren wir einen Fischer mit einem völlig normalen Hallo, so als führten wir rein gar nichts im Schilde. Mit all diesen schlagenden Herzen in einer Stadt bist du niemals allein. Augen: von einer weit entfernten Kamera oder hinter einem versteckten Vorhang. Es scheint, als könne man in einer Stadt wie New York City nichts verheimlichen. Mithilfe der Slogans, die überall in den U-Bahnen angeschlagen sind, wird den Amerikanern Wachsamkeit eingetrichtert: Wenn du etwas siehst, sag etwas! Als Vorbereitung auf das erhöhte Risiko unserer bevorstehenden Aufgabe ignorieren wir selbstbewusst die Schilder, die vor illegalem Zutritt warnen. Das Erreichen der Ruinen verlangt eine gemäßigte Form des Einbrechens. Fragen über Fragen: was ist, wenn uns jemand findet? Was würden wir sagen? Auf Wiedersehen, und wir werden so etwas nie wieder tun. Hinter den Ketten kommt einem der Zement heißer vor, die Straße wirkt aufgewühlt, die Bäume scheinen stärker vom Wind gezeichnet, und die Fenster von Manhattan und Queens sind nah genug, dass man sie mit einem Stein treffen könnte. Indem wir uns den Ruinen im Schatten des wogenden, grünen Unkrautdschungels nähern, einen matschigen, von Katzenpfoten markierten Pfad entlanglaufend, sehen wir die sich müde neigende Fassade, übersät mit Weinstöcken und kaum mehr imposant. Handwerkliches Können ist erkennbar, doch die flimmernde Vegetation ist aufwendiger und beeindruckender. Das Gestein fällt im Zeitlupentempo in sich zusammen. Oben krümmt sich eine Wand bedenklich nach außen, kurz davor einzustürzen; eine hängende Welle, Sekunden bevor sie auf den Strand aufschlägt. Einen Moment lang müssen wir jegliche Ausgelassenheit unterdrücken. Unsere Heimlichtuerei veranlasst uns zu einer gebückten Haltung; ein Hals, scheinbar mit Gelenken befestigt, die den Kopf von rechts nach links bewegen. Es ist ein bisschen wie ein spiegelverkehrter Schatten, der „nein, nein, nein” zu etwas sagt, das er in Wahrheit unbedingt haben will. Mit breitem Lächeln und zugleich verblüfft, schaffen wir es schließlich in das Gebäude: ein Luftzug ist spürbar, und von all dem Schutt fühlt sich das Gemäuer kühl an. Staub hat sich niedergelegt, und Feuchtigkeit nagt durch das hohe Gras an unseren Waden. Zerstörung, Verlassenheit und ein melodisches Dröhnen sind so fein ineinander verstrickt, dass wir uns bewusst daran erinnern müssen. Die Mauern gleichen sich sanft neigenden Türmen aus Ziegelstein; die Fenster sind größer geworden, klaffen weiter als beabsichtigt und lassen so mehr Licht, mehr Blicke hinein. Die meisten Decken sind völlig verschwunden: das Erdgeschoss öffnet sich in die erste Etage, von der wiederum weite Teile unter freiem Himmel liegen. Durch die Löcher in den Mauern können wir den hellen Pfad sehen, der die Spitze der Insel umrundet. Als ein Jogger auf dem Pfad in Sichtweite kommt, zischen wir uns an, die Köpfe einzuziehen und ruhig zu bleiben. Wir wollen nicht gesehen werden. Wir sind auf der falschen Seite des Zauns. Wir nehmen die Vorgaben unserer Zensoren stillschweigend an, indem wir uns selbst kontrollieren, Wachtürme hinter unserer Stirn errichten. Für uns sind Spaziergänger mit Hund und morgendliche Frischluftschnupperer staatliche Agenten, und wir ducken uns, um uns vor ihnen zu verstecken. Während wir dies alles in uns aufnehmen, bewegen wir uns auf die Nordseite des Gebäudes zu, wo wir uns der kleinen Herausforderung einer Kletterpartie durch ein hohes Fenster stellen. Mit ein bisschen gegenseitiger Hilfe schaffen wir es in den ersten Stock. Links offener Raum – ein Schacht, der mit den Resten einer eisernen Zickzackform auf eine fehlende Treppe verweist. Direkt vor uns liegen riesige Räume ohne Fußböden, die Patienten in Gestalt von überwucherten Bäumen beherbergen. Das Zimmer rechts scheint bewohnt: es ist mit Graffiti aus Meerjungfrauen vergoldet, mit mysteriösen Bolzen in den Wänden beschlagen, von schwebenden Bäumen beschattet und übersät mit Flaschen von Brooklyn Lager Bier und Besos Tags. Alles ist mit einem feinen, grünlichen Staub überzogen, der von den Bäumen zu stammen scheint, die sich in den Fenstern drängen. Wir fragen uns, wie es ein leerer Raum nur schaffen kann, so voll zu wirken. Die Wände des Zimmers sind ein vielschichtiges Pastiche aus Sprühfarbe, Markier- und Lippenstiften. Dies sind Spuren von Menschen; doch irgendwie lässt ein Fingerabdruck mehr als nur ein Lebenszeichen zurück. Jeder Fingerkontakt graviert sich in den Stein. Jedes menschliche Handeln schafft immer mehr Raum für Gras und Unkraut. Sie fressen sich wie Würmer durch die Struktur, sie lösen die Wände auf und drücken so die Gegenwart mit dem Gewicht der Vergangenheit nieder. Natürlich erwartet man Gespenster. Leere scheint unmöglich, selbst wenn sie einem auf die Stirn drückt. Man entwickelt einen erhöhten Sinn für das Mögliche. Dies ist ein Ort, an dem Regeln nicht gelten, ein post-humaner Raum. Die Böden können sich unter einem in Bewegung setzen; eine Wand kann sich in Pulver auflösen; nichts ist solide oder völlig vertrauenswürdig. Die Sinne arbeiten Sonderschichten. Wir können uns nicht auf Annahmen stützen, also ist jeder Schritt eine Art Experiment. Unsere Blicke sind voller Eifer und stechend, unsere Nasenflügel vibrieren. Das bewusste Wahrnehmen belebt. An jeder Ecke könnte eine Unmöglichkeit auf uns lauern. Eine abgetrennte Hand, ein glitzernder Kronleuchter mit brennenden Kerzen, eine aus Rauch geformte Katze. Doch keines dieser Dinge begegnet uns. Die Atmosphäre ist unerbittlich heiter. Dieser Ort, der so viel menschliches Leid beherbergt hat, zerdrückt sich selbst. Alleingelassen wird das zur Ruine gewordene Krankenhaus zu einem bloßen, mit Gras bewachsenen Hügelchen werden. Die Gespenster lassen sich in einem friedvollen Grabhügel nieder. Sonnenlicht tränkt den mottenweichen Staub, und hoffnungsvolle Triebe schießen mit ihren dünnen, geraden Stängeln nach oben. Der Stein und seine Erinnerungen ziehen sich zurück zu ihrem Ursprung hinein in die Insel. Wenn die Ruinen verschwunden sind, werden uns nur noch die historischen Aufzeichnungen daran erinnern, dass dieser Bau je gestanden hat. Das Pockenkrankenhaus wurde 1856 fertig gestellt, als die Krankheit in New York City wütete. Es wurde konzipiert von James Renwick Jr., einem Architekten, dessen Name zumeist mit Wörtern wie prominent und respektiert, elegant und erfolgreich in Verbindung gebracht wird. Er schuf mehrere noch erhaltene New Yorker Gebäude, einschließlich der viel bewunderten Grace Church. Die Kirche sollte den Prunk einer mittelalterlichen Kathedrale nachahmen, ist jedoch aus Holz und Mörtel gebaut, nicht aus Stein. Spätere Porträtfotos zeigen Renwick mit den gesträubten Borsten eines weißen Bartes. Das Krankenhaus wurde nicht nach seinem Erbauer benannt, doch jetzt, da der Bau zerfällt, aufweicht und verlassen ist, spricht man von den Renwick Ruinen. Das Gestein der Fassade ist grauer Gneis; ein Stein, der in einer Grube hier auf der Insel selbst von Sträflingen abgebaut wurde. Das Gestein wurde dabei unter dem Boden und den Wurzeln der Pflanzen herausgerissen, was zum Einbruch der Oberfläche führte. Die Innereien der Insel wurden neu zusammengesetzt. Aus Brocken, Scherben und Abschnitten von edler Vielfalt entstand ein Turm, der von menschlicher Hand in die Form von Kästen, Zimmern und Flächen mit regelmäßigen, ebenen Fenstern gebracht wurde. Die ganze Masse von taumelndem Gestein fügte sich in einer geordneten Konstruktion zusammen. Dank der Arbeit von Sklaven kostete das Projekt nicht mehr als 38.000 Dollar. Das Komitee zum Schutz von Wahrzeichen war im Jahre 1975 beeindruckt von diesem Beispiel des Wiederauflebens der zinnengeschmückten Gotik: „Zusätzlich aufgewertet wird der Eingang durch die massive, turmartige Struktur oben, die vertiefte, gotische Spitzbögen auf Konsolen aufweist und von Zinnen sowie einem kleineren, freistehenden Spitzbogen vollendet wird.” Diese Details sind mittlerweile nur noch in Ansätzen wahrzunehmen. Zwischen dem triumphalen Setzen des letzten Steins (gab es da wohl eine Zeremonie mit Banddurchschneiden? Champagner auf dem Rasen? Wurde den Sträflingsarbeitern von Stadtfunktionären in seidenen Halstüchern zugejubelt?) und der Ernennung der Stätte zum historischen Ort im Jahre 1975 diente das Krankenhaus die meiste Zeit seines bewohnten Lebens als Ort der Quarantäne - gebaut von Gefangenen, um die Kranken und Ansteckenden zum Wohle ihrer nicht infizierten Mitmenschen wegzusperren. Das Haus wurde auch von Gefangenen geleitet; von entbehrlichem, menschlichen Leben also, offiziell als infiziert geführt und der 30%igen Wahrscheinlichkeit des Todes, die eine Pockenerkrankung bedeutete, überlassen. Kranken-häuser gelten generell als Orte der Heilung; Orte, an denen man sich um Kranke kümmert. Die Aufzeichnungen des Roosevelt Island Pockenkrankenhauses erinnern uns aber auch daran, dass Krankenhäuser zur Trennung der Gesunden von den Ungesunden gedacht sind, zur Konzentrierung von Schadstoffen und zum Ausschluss der Infizierten aus der Öffentlichkeit. Quarantäne bedeutete für viele eine Art des aktiven Aussetzens und Verlassens. Ein Aufenthalt im Quarantänehospital konnte verfaultes Essen, Ratten und den Tod mit sich bringen. Die Ruinen sowie die Tatsache ihrer Ruinierung verkörpern den aufgeteilten Bild-schirm der verinnerlichten Überwachung in New York City. Dies ist ein Ort, der gebaut wurde, um zu untersuchen, zu kontrollieren und abzugrenzen, der aber gleichzeitig auch für Vernachlässigung und Nichtachtung steht. Was jetzt Roosevelt Island heißt, war einst als „Wohlfahrtsinsel“ bekannt. Neben dem Pockenkrankenhaus und dem Gefängnis lagen auch eine psychiatrische Anstalt, ein Armenhaus und ein Forschungslabor auf der Insel. Sie war praktisch ein Sonderbereich, ein Ort der Beschlagnahmung, der durch den tiefen East River vom alltäglichen Leben in der Stadt abgeschnitten war. Der Zweck des in Ruinen liegenden Krankenhauses hat sich mittlerweile ins Gegenteil verkehrt: es ist kein Ort der Gefangenschaft mehr, sondern ein Ort des Trostes. Wir drei Abenteurer müssen einbrechen; wir suchen die Internierung, die zuvor so vielen anderen aufgezwungen wurde. Die Vernachlässigung, die in der Quarantäne noch tödlich war, ist zu einer beruhigenden Abgeschiedenheit geworden. Staubige Kegel ruhigen Lichtes; Türen, die sechs-sieben Meter schief über dem nächsten Boden hängen; Gärten, die sich durch Fenster und über Mauern austoben. Isolation fühlte sich nie so gewährleistet an. Wir sind traurig, wieder zu gehen, als wir uns schließlich durch hohes, grünes Gestrüpp in das gleißende Licht der Mittagssonne zurückkämpfen. Über den Zaun, zurück in die Stadt. Jogger laufen an uns mit ihren Kopfhörern vorbei. Ob wir gesehen werden oder nicht, niemand sagt etwas. Foto: Monica Cook, Sarah Lippek und Arlene Tucker.
01.03.2007
Empfohlene Artikel
|
|||||||||||||
|
04.02.2020 10:17
Letošní 50. ročník Art Basel přilákal celkem 93 000 návštěvníků a sběratelů z 80 zemí světa. 290 prémiových galerií představilo umělecká díla od počátku 20. století až po současnost. Hlavní sektor přehlídky, tradičně v prvním patře výstavního prostoru, představil 232 předních galerií z celého světa nabízející umění nejvyšší kvality. Veletrh ukázal vzestupný trend prodeje prostřednictvím galerií jak soukromým sbírkám, tak i institucím. Kromě hlavního veletrhu stály za návštěvu i ty přidružené: Volta, Liste a Photo Basel, k tomu doprovodné programy a výstavy v místních institucích, které kvalitou daleko přesahují hranice města tj. Kunsthalle Basel, Kunstmuseum, Tinguely muzeum nebo Fondation Beyeler.
|
























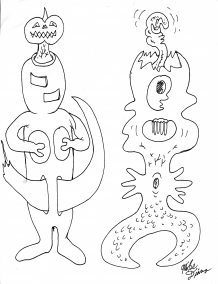










 We Are Rising National Gallery For You! Go to Kyjov by Krásná Lípa no.37.
We Are Rising National Gallery For You! Go to Kyjov by Krásná Lípa no.37.
Kommentar
Der Artikel ist bisher nicht kommentiert wordenNeuen Kommentar einfügen